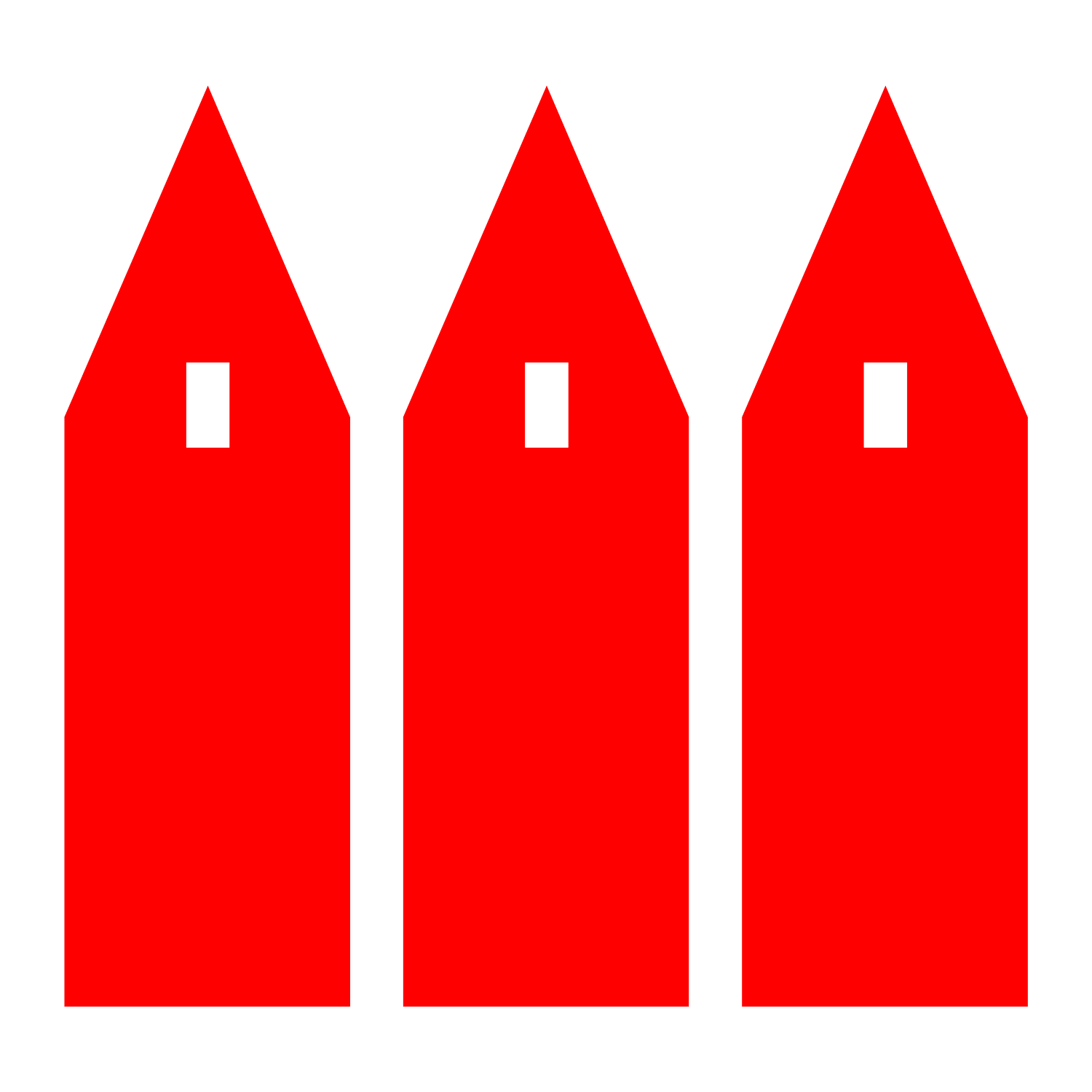Wir müssen der Stadt den Hof machen
Günstiger, lebendiger und ökologischer: Mit dem Typus des Flügelhauses ließen sich gleich mehrere Herausforderungen im Wohnungsbau bewältigen, sagt der Architekt Christoph Mäckler. Er hofft auf ein Modellquartier und setzt auf junge Kollegen.
Derzeit wird wieder viel darüber gesprochen, dass möglichst viel möglichst schnell und günstig gebaut werden muss. Fragen nach Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, wie Sie die Konferenz Ihres Instituts jetzt zum fünfzehnten Mal stellt, scheinen in der Debatte kaum eine Rolle zu spielen.
Die Politik versteht gar nicht, dass der öffentliche Raum eigentlich der Sozialraum unserer Gesellschaft ist und dass wir, wo immer wir irgendwelche Fertigteilbuden auf die grüne Wiese stellen, die Banlieues der Zukunft schaffen. Die Politik hat nur das Ziel vor Augen, möglichst schnell Wohnungen zu bauen. Aber wir müssen Stadt bauen, so wie die Gesellschaft diese Stadt liebt, nämlich mit ihrer funktionalen Mischung, mit ihrer Dichte, sozialer Vielfalt und so weiter und so fort. Die Schönheit der Stadt hat einen ganz starken Einfluss auf den Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
Wenn die Politik immer noch so ignorant ist: Was haben Sie in all den Jahren erreicht?
Dazu, dass über den städtischen Raum als sozialen Raum unserer Gesellschaft wieder mehr gesprochen und nachgedacht wird in Deutschland, haben wir beigetragen. Als wir anfingen, war es geradezu eine Provokation, von der Schönheit der Stadt zu sprechen. Das hat auch zu viel Aufruhr geführt. Man hat uns zum Teil belächelt. Entscheidend ist aber, dass die Dezernenten der Städte, die verantwortlichen Planungsdezernenten und Baubürgermeisterinnen, unsere Anliegen wahrgenommen haben. Sie kommen in beachtlicher Zahl zu unseren Konferenzen, während wir in der Bundespolitik mit unseren Anliegen auf taube Ohren stoßen, egal welche Partei da gerade das Sagen hat. Die kommunalen Akteure tragen unsere Ideen dann in ihre Städte und versuchen, sie dort voranzutreiben, jeder auf seine Weise. Und das kann man den Städten auch durchaus schon ansehen.
Wirklich? Wenn man durch Neubaugebiete hierzulande fährt und sich die zumeist deprimierend leblose Atmosphäre vor Augen führt, die dort herrscht, könnte man den gegenteiligen Eindruck haben.
Ja, das sind dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Aber es gibt punktuell schon Fortschritte. Nehmen wir das Beispiel München. Ich bin unlängst mit der Baubürgermeisterin der Stadt München durch den Nockherberg gegangen, da wurden vor vielleicht fünf Jahren drei, vier riesige Blöcke gebaut. Dort gibt es beispielsweise wieder geschlossene Höfe, wie sie in der europäischen Stadt üblich sind.
Es handelt sich also um eine klassische Blockrandbebauung?
Ja, genau. Klassische Blockrandbebauungen von unterschiedlichen Architekten, sodass man auch unterschiedliche Gebäude hat. Da ist schon etwas Besonderes entstanden. Ich will aber nicht behaupten, dass das alles auf das Wirken unseres Instituts zurückgeht. Vielmehr ist es auch Ausdruck von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir sind ein Rädchen in diesem Getriebe, indem wir die einschlägigen Fragen diskutieren und die Debatten darüber auch publizieren.
Die Konferenzen sind ein Schwerpunkt, das Institut betreibt aber auch Forschung.
Ja, es ist intensive Forschung, von der ich selbst übrigens auch stark profitiere. Als ich damals an der RWTH Aachen studiert habe, hat man mir auch nicht gesagt, was ein Block ist und wie eine Straßenfassade auszusehen hat und welche Dachformen es gibt. Das sind alles Themen, die eigentlich jetzt erst so langsam wieder zum Tragen kommen. Es ist mühsam, das Erbe der Achtundsechziger und ihre Fixierung auf theoretische Begriffe und Prozesse zu überwinden, in denen der architektonische Raum der Stadt noch immer keinen Platz hat.
Interessiert das die Studenten überhaupt?
Ja, die junge Generation greift das begierig auf, wenn man ihr das Angebot macht. Bis heute aber studieren junge Leute beispielsweise an der TU Dortmund noch immer Raumplanung, ohne etwas über Städtebau oder Architektur zu erfahren. So wissen sie am Ende ihres Studiums nicht, wie ein Wohnungsbau funktioniert, sitzen nachher aber in den Stadtplanungsämtern und sollen ein Wohngebiet entwickeln. Ohne das Wissen der Architektur beherrschen sie aber nur den Planungsprozess und können nichts vom Stadtraum und seinen Regeln verstehen.
Die Konferenz, die am Dienstag beginnt, widmet sich dem Thema des städtischen Hofes. Was macht ihn aus Ihrer Sicht wichtig?
Sämtliche europäischen Städte kennen Quartiere mit Höfen. Höfe entstehen dadurch, dass ich Flügelanbauten habe an den Häusern. Und in den Höfen haben die Bewohner eines Mietshauses eine eigene Freifläche, einen geschützten Ort, der klar vom öffentlichen Raum getrennt ist. Sie können ihn gemeinsam gestalten und nutzen, und auf diese Weise kann sich eine Hausgemeinschaft entwickeln.
Und es dürfte sich um einen Typus handeln, von dem viele Menschen profitieren könnten.
Wir haben in Deutschland mehr als 50 Prozent Mietwohnungsbau. Das ist einmalig in Europa, aber den Mietern wird in unseren Neubaugebieten kein eigener Hofraum oder Gartenraum geboten, wo sie mal an ihrem Fahrrad schrauben können oder eine Sandkiste aufstellen können, in der die Kinder in einer sicheren Umgebung spielen. Stattdessen stehen ihre Häuser vereinzelt in einem durchgrünten Raum, von dem unklar ist, ob er nun eigentlich privat oder öffentlich ist. Das wollen wir ändern, übrigens auch im geförderten Wohnungsbau. Für den kommt unsere Arbeit am Typus des Flügelhauses mit Höfen auch deshalb infrage, weil sich mit ihm ungeahnte Effizienzen heben lassen. Wir haben eine entsprechende Planung probehalber auf zwei in den letzten Jahren errichtete Neubaugebiete gelegt, einmal in Hannover-Kronsrode und einmal in Frankfurt-Riedberg. Und dann kamen da plötzlich Zahlen heraus, die mich geradezu umgehauen haben. Man kann durch diese Bauweise 30 bis 40 Prozent der Erschließungsfläche, also an Straßenraum, einsparen. Das heißt, ich hätte 30 bis 40 Prozent weniger versiegelten Boden gehabt, den ich beispielsweise für einen Park hätte verwenden können.
Bei gleicher Wohnfläche?
Bei gleicher Wohnfläche. Und das hat natürlich einen enormen ökologischen und ökonomischen Aspekt. Der Typus des Flügelhauses führt zur Stadt der kurzen Wege, weil die Häuser, statt parallel zur Straße zu stehen, sich mit dem Flügelanbau in die Tiefe des Grundstücks hinein entwickeln. Und er ist damit für jede Wohnungsbaugesellschaft wegen der deutlich niedrigeren Grundstücks- und Erschließungskosten unglaublich interessant. Wir bewegen uns da in einer Dimension, die den Wohnungsbau spürbar günstiger machen würde, weit mehr als die anderen Maßnahmen, die gerade diskutiert werden, die sich aber weitgehend auf das jeweilige Haus und seine Konstruktion fokussieren. Durch eine Bebauung mit dem Typus des Flügelhauses kann die kostendeckende Miete wieder unter 16 Euro kommen, wie das die Bundesbauministerin möchte.
Mit einer lockeren Bebauung ist für mehr Licht und Luft gesorgt. Und beim Wort Hof denkt man an die dunklen Hinterhöfe der Berliner Mietskasernen.
Es ist ja so, dass man in Zeiten des Klimawandels durchaus stärker verschattete Wohnungen haben will. Unsere Untersuchungen haben zudem ergeben, dass in den Höfen unserer Modellplanungen keineswegs eine düstere Atmosphäre herrscht, sondern eine angenehme Verschattung. Darüber hinaus sind die Flügelhäuser auch in offener Bauweise anwendbar, wie das zuvor genannte Beispiel in Frankfurt-Riedberg zeigt.
Wen müssen Sie gewinnen, wenn Sie Ihre Ideen häufiger realisiert sehen wollen?
In einigen Planungsdezernaten ist man da sehr aufgeschlossen. Wir machen beispielsweise Workshops zusammen mit den Stadtplanungsämtern.
Gibt es schon konkrete Pläne, die Maximen des Instituts in der Praxis anzuwenden?
In drei Städten ist man an einem Pilotprojekt mit Flügelhausbauten sehr interessiert. Und jetzt muss das Institut einen Projektentwickler und eine Stadt zusammenbringen, was nicht banal ist, denn die Grundstücke müssen öffentlich ausgeschrieben werden. Wir sind jedenfalls an dem Punkt, dass zu allen wichtigen Fragen valide Forschungsergebnisse vorliegen. Wir werden aber nur dann weiterkommen, wenn wir sie in der Praxis erproben. Deshalb möchten wir mit einer Stadt, einem Investor und mit Architekten zusammen ein Modellquartier errichten - mit Straßen unterschiedlichster Typologien, mit Plätzen, mit Höfen, in geschlossener Bauweise, in offener Bauweise. Unsere Vorstellung ist, dass wir junge Architektinnen und Architekten gewinnen, auf der Grundlage unserer städtebaulichen Forschungen dann dort die einzelnen Häuser zu bauen.
Dem Institut und Ihnen persönlich wurde immer vorgeworfen, ästhetisch konservativ zu sein, etwa mit Blick auf die Gestaltung der Fassaden und die verwendeten Materialien. Wie liberal wären Sie, was die Gestaltung der einzelnen Häuser im Rahmen eines solchen Pilotprojekts angeht?
Diese Kritik ist so dämlich, dass ich gar nicht mehr darüber reden will. Wer meine Architektur kennt, der weiß, dass ich mir durchaus unterschiedliche Architekturen vorstellen kann. Wenn man die städtebaulichen und typologischen Fragen geklärt hat, dann spielt die Straßenfassade eine Rolle, weil sie den öffentlichen Raum gestaltet. Und selbstverständlich muss es gute Gestaltung geben. Das heißt aber nicht, dass es dort Stuckleisten geben muss. Sie muss nur gut proportioniert sein. Und sie kann keine Glasfassade sein. Glasfassaden haben nicht die Haptik, um den städtischen Raum begreifbar zu machen. Und sie sind in Zeiten des Klimawandels ökologisch einfach von vorgestern. Die Glasfassade bringt einen enormen Wärmeeintrag, der nur mit viel Energie wieder aus dem Haus herauszuschaffen ist.
Also fordern Sie eine klassische Fassade mit Fenstern, eine sogenannte Lochfassade.
Genau, und die Fenster können dann durchaus groß sein, je nachdem, wie groß der Raum ist, der dahinter liegt. Der Rest der Fassade kann aus Putz sein oder aus Naturstein oder wie auch immer.
Und der Bürger muss mitspielen, denn der zeigt sich ja gegenüber allen Neubauprojekten skeptisch bis ablehnend.
Natürlich. Aber diese Bürgerbeteiligung, die wir mittlerweile im Übermaß haben, erklärt sich auch aus unserer Inkompetenz als Planer. Ich muss umso länger diskutieren, je weniger ich mit meinem Wissen plausibel machen kann, warum etwas so oder so sein muss. Bürgerbeteiligung ist schon wichtig, aber sie muss fachlich funktionieren. Es geht nicht, dass man dem Bürger einen Bleistift in die Hand gibt, er soll jetzt mal die Stadt zeichnen. Es ist Augenwischerei, wenn wir so tun, als wenn wir alle an allem beteiligen könnten.
Die Fragen stellte Matthias Alexander.
Erschienen in der F.A.Z., 30.06.2025, Nr. 148, Feuilleton, S. 13, D0
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv